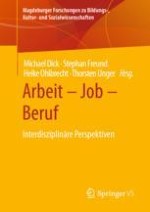Der Sammelband nimmt aus sozial-, bildungs-, geschichts- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven aktuelle Facetten des Arbeits- und Erwerbslebens in den Blick und beleuchtet zudem wichtige Entwicklungsstationen einer (Kultur-) Geschichte der Arbeit. Die aus dem gegenwärtigen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt im Zeichen von Digitalisierung und Globalisierung resultierenden Änderungen betreffen alle Sektoren: Produktion, Handel, Dienstleistungen, auch die Kulturwirtschaft. Art, Struktur und Organisation der Arbeit selbst ändern sich, zudem aber auch Lebensweisen, das Verhältnis von Arbeits- und Privatleben, räumliche und zeitliche Arrangements des tätigen Lebens, Kommunikationsgepflogenheiten, Sozialstrukturen, Werthaltungen zu Erwerbsarbeit und Nicht-Arbeit und deren kulturelle Reflexion. Vergleichbare Transformationen gab es bereits in den drei vorangegangenen „industriellen Revolutionen“. Daher stellt sich die Frage: Wie können wir uns auf derartige Prozesse vorbereiten oder sie wenigstens reflektieren und zu verstehen versuchen?